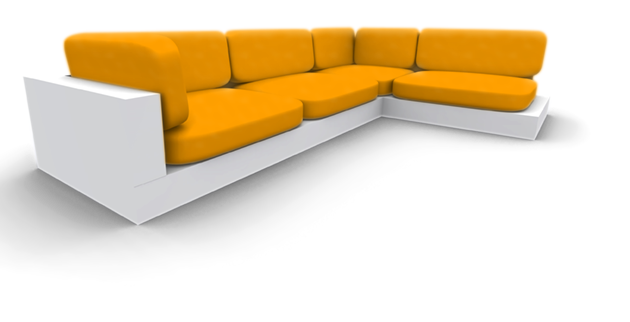| Autor | Beitrag | ||
|---|---|---|---|
THF       
Beiträge: 110 Vista Delphi 2005 professional |
Hallo,
ich möchte in einem Nebenformular in der Unit2 in einem Edit-Feld etwas eintragen zum Beispiel 'Hallo' dies soll dann nach Bestätigung auf den OK-Button in ein Label im Hauptformular Unit1 eingetragen werden. Ich bekomme dabei immer Fehlermeldungen weil man vom Nebenformular nicht auf das Hauptformular zugreifen kann. Gruß THF Moderiert von Zuletzt bearbeitet von THF am Do 24.03.05 07:08, insgesamt 1-mal bearbeitet |
||
IngoD7       
Beiträge: 629 D7 |
Ist die Unit1 per uses-Anweisung in Unit2 eingebunden?
|
||
THF         
Beiträge: 110 Vista Delphi 2005 professional |
Hallo,
nein umgekehrt Unit2 ist bei uses in Unit1 eingebunden. Gruß THF |
||
|
abakama Hält's aus hier Beiträge: 10 Win ME D4 |
Du musst die Unit 1 auch in der Unit 2 einbinden.
|
||
THF         
Beiträge: 110 Vista Delphi 2005 professional |
Hallo,
also das funktioniert nicht, wenn ich Unit1 in Unit2 einbinde und dann noch unit2 in Unit1 einbinde. Ich glaube das funktioniert nicht! Oder ? ? Gruß THF |
||
retnyg       
Beiträge: 2754 SNES, GB, GBA, CPC, A500, 486/66, P4/3.0HT: NintendOS, AmigaOS, DoS Delphi 5, Delphi 7 |
glaube nicht, probiere es einfach.
_________________ es gibt leute, die sind genetisch nicht zum programmieren geschaffen. in der regel haben diese leute die regel... |
||
THF         
Beiträge: 110 Vista Delphi 2005 professional |
Hallo,
ich habs ausprobiert, funktioniert nicht! Überkreuzender Bezug zweier Units. Gruß THF |
||
Holgerwa       
Beiträge: 325 WIN XP Pro, Vista Business Delphi 7 Pro, BDS 2006 Pro |
Hallo,
setz mal das "Uses Unit1" nicht in den Interface-Teil von Unit2, sondern direkt nach "Implementation", dann funktionierts. Holger |
||
AXMD       
Beiträge: 4006 Erhaltene Danke: 7 Windows 10 64 bit C# (Visual Studio 2019 Express) |
Hi
Bitte ändere deinen Titel deines Beitrags so, dass er den Richtlinien entspricht. Dazu einfach den EDIT-Button rechts oben verwenden.
Danke AXMD |
||
magic87       
Beiträge: 45 Delphi 7, PHP |
Der Beitrag wird jetzt erstmal wieder ein bisschen nach oben gepusht!=)
Ich wollte nämlich gerne wissen, warum es einen "Überkreuzenden Bezug" gibt, wenn man die Units gegenseitig im Inteface einbindet und wenn man die eine Unit im Interface und die andere im Implementation-Teil einbindet dann klappt es! Hat dafür jemand eine logische und verständliche Erklärung? Gruß Bluemagicon |
||
arj       
Beiträge: 378 Win XP/Vista, Debian, (K)Ubuntu Delphi 5 Prof, Delphi 7 Prof, C# (#Develop, VS 2005), Java (Eclipse), C++, QT, PHP, Python |
Kurzes Beispiel:
Der Compiler prüft beim Compilieren, ob die Typen zueinander passen, also ob du eine Funktion, die einen Integer erwartet, auch mit einem Integer aufrufst. Dafür muss er allerdings nur die Signatur kennen. Diese wird bei * a * definiert. Die Implementation, also der eigentliche Code der Funktion (* b *) muss keiner Typenprüfung nach außen hin standhalten. Da muss nur intern alles stimmen. Also müssen vor dem jeweiligen Benutzen der anderen Funktionen die Signaturen bekannt sein, damit der Compiler bei * c * prüfen kann, ob du die Funktion korrekt aufrufst. Dass erreicht man damit, indem man die Units gegenseitig im Implementation-Teil einbindet, da hier dann einfach nur die Signaturen geschrieben werden müssen. Ich hoffe es ist klarer geworden |
||